Neuigkeiten im Fall Diarra
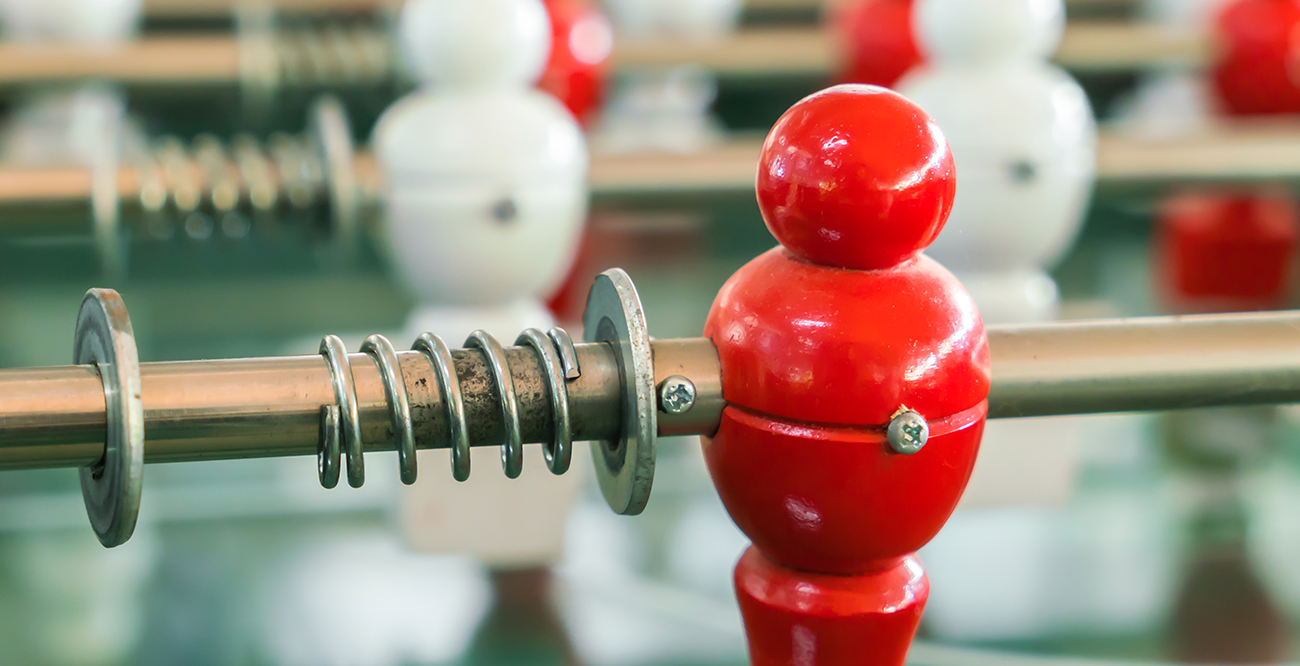
Mehr als ein Jahr nach dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) im „Fall Diarra“ macht der Hauptakteur, der Fußballspieler Lass Diarra, gegenüber der FIFA und dem belgischen Verband Schadensersatzansprüche in Höhe von 65 Millionen Euro geltend. Zusätzlich betreibt die niederländische Stiftung Justice for Players (JfP) eine Sammelklage im Namen von bis zu 100.000 Profispielern (die genauen Zahlen sind nicht bekannt), um ebenfalls millionenschwere Entschädigungen gegen die FIFA und weitere nationale Verbände – unter anderem den deutschen Verband (Deutscher Fußball-Bund) – durchzusetzen. Grundlage dieser Reklamationen ist jeweils die Entscheidung des EuGH im Urteil Diarra, wonach das Transfersystem der FIFA teilweise mit dem durch Art. 45 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) garantierten Grundrecht auf Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der Europäischen Union, und damit mit dem Unionsrecht, unvereinbar ist.
Obwohl ungewiss ist, ob die von Justice for Players eingeleiteten Klagen Erfolg haben werden, beziehungsweise ob die Ansprüche von Diarra gerechtfertigt sind und ob er den geltend gemachten Schaden nachweisen kann, steht fest, dass das Urteil erhebliche Bewegung abseits des grünen Rasens ausgelöst hat. Hervorzuheben ist auch die Präsenz einer Stiftung wie JfP, die offenbar über eine erhebliche Mobilisierungskraft unter den Spielern verfügt, sowie die Unterstützung der Spielervereinigung FIFPRO bezüglich der Forderungen Diarras.
Der Kern des Problems ist ähnlich wie in früheren Urteilen des EuGH zum Sport, etwa im „Bosman-Urteil“. Der Profifußball ist nicht nur Sport und bewegt viele Fans, sondern es handelt sich auch um eine wirtschaftliche Tätigkeit und unterliegt als solche dem Recht der Europäischen Union, beispielsweise dem Recht auf Freizügigkeit der Profifußballer oder anderer Arbeitnehmer. Auf der anderen Seite sehen sowohl die FIFA als auch die UEFA die – wohl berechtigte – Notwendigkeit, die Vertragssicherheit zu gewährleisten, Transfers zu regulieren usw., alles mit dem Ziel, einen fairen Wettbewerb zu sichern. Es ist nicht einfach, auf Verbandsebene Lösungen zu finden, die sowohl die Ziele von FIFA und UEFA erfüllen als auch im Einklang mit dem unionsrechtlichen Rahmen und den nationalen Rechtsordnungen stehen.
In der Praxis scheint es auch in Zukunft unvermeidlich, dass sowohl der EuGH als auch nationale Gerichte Korrekturen an den Regelungen der FIFA und UEFA vornehmen werden und dass die Verbände ihre internen Regelwerke an diese Urteile anpassen müssen. Die entscheidende Frage ist, in wieweit dadurch wirtschaftliche und strukturelle Auswirkungen eintreten. Im Fall Diarra sind jedenfalls zumindest die potenziellen finanziellen Folgen ganz erheblich.

